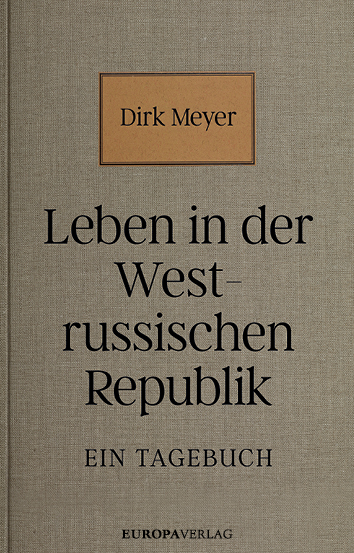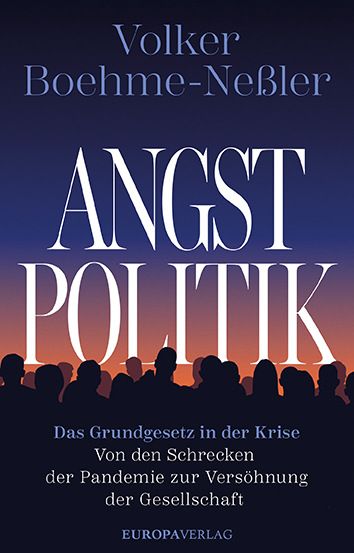Dirk Meyer
18,00 € (D) / 18,50 € (A) inkl. MwSt.
ISBN 978-3-95890-678-5
Leben in der Westrussischen Republik
Ein Tagebuch
ca. 180 Seiten
gebunden mit Leinen-Charakter
12,5 x 19,5 cm
Erschien im Januar 2026
18,00 € (D) / 18,50 € (A) inkl. MwSt.
ISBN 978-3-95890-678-5
Ein gefundenes Tagebuch aus einem besetzten Deutschland
Im Herbst 2029 wird in einem verlassenen Haus nahe Hildesheim ein Manuskript entdeckt. Es stammt von Elias Franke, 49 Jahre alt, der in den Jahren der sogenannten „Westrussischen Republik" Tagebuch geführt hat. Wenige Stunden nach Vollendung seiner Aufzeichnungen nimmt er sich das Leben.Seine Notizen beginnen mit dem militärischen Angriff: Russische Streitkräfte landen – getarnt in einer Schattenflotte – in der Lübecker Bucht, dringen in das Land ein, und innerhalb einer Woche kapituliert die deutsche Regierung. Was folgt, ist der Alltag unter einer neuen Besatzungsordnung. Franke berichtet von Lautsprecherwagen, Registrierungslisten und verschwundenen Nachbarn. Die Angst greift schnell um sich, während die Propaganda Schulen, Supermärkte und Fernsehen durchdringt. Er beschreibt, wie eine Gesellschaft sich schrittweise verändert: wie Schweigen zur Gewohnheit wird, wie Menschen verschwinden, wie Zwangsrekrutierungen beginnen. So entsteht das Bild einer fiktiven Besatzungsordnung, die Freiheit und Alltag von innen heraus zerstört.Das Tagebuch bleibt dabei immer nah an der Familie: an den Kindern, die plötzlich Russisch lernen müssen; an der Frau, die er verliert; an den Freunden, die verstummen oder verschwinden. Zwischen intimen Szenen und politischer Chronik entsteht so ein beklemmendes Bild einer Gesellschaft im Ausnahmezustand.Tagebuch – Leben in der Westrussischen Republik ist kein Heldenepos, sondern die Chronik eines gewöhnlichen Mannes, der versucht, im Strudel der Geschichte Mensch zu bleiben. Es ist ein stilles, aber eindringliches Dokument – ein Roman, der sich liest wie ein authentisches Fundstück, zugleich Zeitzeugnis und Warnung, wie zerbrechlich Freiheit ist – und ein literarisches Friedensprojekt, das zum Innehalten anregt.
- Ein Roman in Tagebuchform – authentisch, nahbar, literarisch verdichtet
- Ein Gedankenexperiment über den Zerfall von Freiheit
- Ein literarisches Friedensprojekt über den Wert von Freiheit und Demokratie
- Keine Dystopie in ferner Zukunft, sondern eine Erzählung, die bewusst nah an der Gegenwart bleibt
- Atmosphärisch dicht, emotional packend, mit präziser Beobachtung des Alltags im Autoritarismus
- Anschlussfähig an aktuelle Debatten über Propaganda, Krieg, Freiheit und Erinnerungskultur
„Dieses Tagebuch ist ein Versuch, sichtbar zu machen, wie zerbrechlich Freiheit ist – und wie leise sie verschwindet, wenn wir uns zu sicher fühlen."
– Dirk Meyer
Nachwort des Autors:
Dieses Buch ist Fiktion – und doch nicht fern von dem, was Geschichte und Gegenwart uns lehren. Viele der beschriebenen Mechanismen basieren auf realen Entwicklungen: Propaganda, Desinformation, Polarisierung und die schleichende Erosion demokratischer Strukturen.
Mein Ziel war es nicht, Angst zu erzeugen, sondern Bewusstsein. Zu zeigen, wie verletzlich Freiheit ist – und wie kostbar.
Die historischen Parallelen sind bekannt, die Warnsignale sichtbar. Doch oft scheitert es nicht am Wissen, sondern am Willen, hinzusehen. Demokratie lebt nicht von Helden, sondern von Menschen, die aufmerksam bleiben, die zuhören, die Widerspruch aushalten und die bereit sind, auch die eigene Haltung zu hinterfragen.
Dieses Buch richtet sich gegen jede Form von Diktatur und Menschenverachtung – nicht aus moralischer Überhöhung, sondern aus der Überzeugung, dass wir einander wieder als Menschen sehen müssen, nicht als Feindbilder.
Wenn dieser Roman eines kann, dann vielleicht das: daran erinnern, dass wir es in der Hand haben, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt.
Dirk Meyer